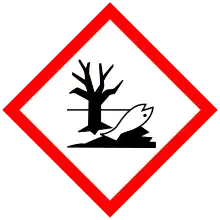Chrom(III)-chlorid
Chrom(III)-chlorid ist das Chromsalz der Salzsäure mit der Summenformel CrCl3. Mit Hydratwasser kristallisiert es auch als Chrom(III)-chlorid-hexahydrat (CrCl3 · 6 H2O).
| Kristallstruktur | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-chlorid.png.webp) | ||||||||||||||||||||||
| _ Cr3+ _ Cl− | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
| Name | Chrom(III)-chlorid | |||||||||||||||||||||
| Andere Namen |
Chromtrichlorid | |||||||||||||||||||||
| Verhältnisformel | CrCl3 | |||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | ||||||||||||||||||||||
| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| Molare Masse | ||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||||||||
| Dichte |
2,87 g·cm−3[3] | |||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
| Löslichkeit | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||
Gewinnung und Darstellung
Chrom(III)-chlorid kann durch Reaktion von Chrom mit Chlor gewonnen werden.[4]
Die wasserfreie Verbindung ist im Labor aus dem Hexahydrat über dessen Umsetzung mit Thionylchlorid[5] oder die Chlorierung von frisch hergestelltem Chrom(III)-oxid mit Tetrachlormethan bei 620 °C[6] zugänglich:
Eigenschaften
-chloride-purple-anhydrous-sunlight.jpg.webp) Wasserfreies Chrom(III)-chlorid
Wasserfreies Chrom(III)-chlorid![Das Hexahydrat [CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O](../I/Chlorid_chromit%C3%BD.JPG.webp) Das Hexahydrat [CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O
Das Hexahydrat [CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O
Es bildet kristalline Schichtstrukturen, in denen zwischen den Schichten Van-der-Waals-Kräfte auftreten. Das Salz, das rotviolett glänzende Kristalle bildet, ist in reiner Form in Wasser unlöslich[2] und in Ethanol schwer löslich. Erst in Anwesenheit von Spuren Chrom(II)-chlorids (CrCl2) (oder eines anderen Reduktionsmittels) ist ein Lösungsvorgang in Wasser katalytisch unter starker Wärmeabgabe möglich.[7] In Lösung können sich unterschiedlich gefärbte hydratisomere Aquakomplexe bilden, beispielsweise das dunkelgrüne Dichlorotetraaquachrom(III)-chlorid, das hellgrüne Chloropentaaquachrom(III)-chlorid oder das violette Hexaaquachrom(III)-chlorid. Hierbei stellen sich zwischen diesen Komplexen folgende Gleichgewichte ein:[2]
Herstellung
Chrom(III)-chlorid kann aus metallischem Chrom im Chlorstrom bei 600 °C synthetisiert werden.[7] Ebenso ist die Herstellung aus Chrom(III)-oxid und Kohle im Chlorstrom oberhalb von 1200 °C möglich.[2]
Verwendung
Chrom(III)-chlorid wird als Katalysator, zur Herstellung anderer Chromverbindungen, zur Verchromung in der Galvanotechnik und zur Wasserdichtimprägnierung verwendet.[1]
Chrom(III)-chlorid darf in der EU bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden.[8] In Nahrungsergänzungsmitteln wird neben Chrom(III)-chlorid auch Chrom(III)-nicotinat und Chrom(III)-picolinat verwendet.[9] Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, das Nahrungsergänzungsmittel höchstens 60 µg Chrom pro Tagesverzehrempfehlung enthalten sollen.[10] Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz für positive gesundheitliche Effekte einer Chromaufnahme bei gesunden Menschen.[10]
Weblinks
Einzelnachweise
- Eintrag zu Chromchloride. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 29. Mai 2013.
- A. F. Holleman, E. Wiberg, N. Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-017770-1, S. 1573.
- Eintrag zu Chrom(III)-chlorid in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 2. Januar 2024. (JavaScript erforderlich)
- Georg Brauer (Hrsg.) u. a.: Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie. 3., umgearbeitete Auflage. Band III, Ferdinand Enke, Stuttgart 1981, ISBN 3-432-87823-0, S. 1481.
- Alfred R. Pray: Anhydrous metal chlorides. In: Therald Moeller (Hrsg.): Inorganic Syntheses. Band 5. McGraw-Hill, Inc., 1957, S. 153–156 (englisch).
- A. Vavoulis et al.: Anhydrous chromium(III) chloride. In: Eugene G. Rochow (Hrsg.): Inorganic Syntheses. Band 6. McGraw-Hill Book Company, Inc., 1960, S. 129–132 (englisch).
- E. Riedel, C. Janiak: Anorganische Chemie. 8. Auflage. de Gruyter, 2011, ISBN 3-11-022566-2, S. 813 f.
- Richtlinie 2002/46/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmittel. Online Verfügbar. Abgerufen am 28. März 2024.
- Michael Adolph: Ernährungsmedizin nach dem neuen Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer; 276 Tabellen. Georg Thieme Verlag, 2010, ISBN 978-3-13-100294-5, S. 205 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
- Höchstmengenvorschläge für Chrom in Lebensmitteln inklusive Nahrungsergänzungsmitteln. Stellungsnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung. Online Verfügbar. Abgerufen am 28. März 2024.